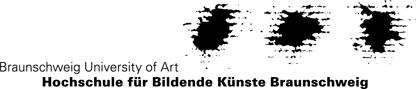21.42 Geschichte der Photographie
3 search hits
-
Hybride Bilder : Studien zum Produktivwerden technischer Reproduktion (1880-1930)
(2008)
-
Ines Lindner
- Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der spezifische Produktivität der reproduktiven Medien für die Bildpraktiken im 20. Jahrhundert. Als Basis der Produktivität erweisen sich in der medienhistorisch orientierten Untersuchung gerade die Eigenschaften technischer Reproduktion, die für eine Destabilisierung des traditionellen Bildbegriffs gesorgt haben: Die hybride Verfassung technischer Bilder und ihre massenhafte Verbreitung. Die massenhafte Verbreitung schafft nicht allein ein unerschöpfliches und leicht verfügbares Bildreservoir; sie ändert das Verhältnis von Bild und Schrift. Die hybride Verfassung technischer Bilder, die nie reine Aufzeichnung sind, aber auch nie bloss individueller Ausdruck, erfordert ein ständiges Aushandeln zwischen der technisch apparativen und der gestalterischen Seite. Die gegenüber dem 19. Jahrhundert tiefgreifend veränderten Bildstrategien des 20. Jahrhundert entwickeln sich im Kontext neuer visueller Ökonomien, die sich zwischen 1880 und 1930 herausbilden. Das erste Kapitel befasst sich mit der Hybridität des Mediums Fotografie. Es verfolgt historische Aushandlungsprozesse, die seine Geschichte bestimmt haben. Am prägnanteste zeigt Alfred Stieglitz’ Versuch, die Fotografie kunstfähig zu machen, wie überaus komplex sie sind. Als Fotograf, Kunsttheoretiker und Vermittler arbeitet er auf vielfachen Ebenen mit Hybridisierungen, um dem neuen Medium eine Akzeptanz im Kunstbereich zu sichern. Er beginnt damit, fotografische und malerische Techniken zu verschränken, geht über zur Schaffung hybrider Räume, in denen er Fotografie und Kunst gemeinsam präsentiert, und entwickelt schließlich das Konzept einer genuin amerikanischen Kunst, in der die Fotografie integrativer Bestandteil ist. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Effekten technischer Reproduktion. Ende der 20er Jahre steigt die Produktion und Zirkulation analoger Bilder sprunghaft an. Theoretiker wie Kracauer und Benjamin reagieren kritisch auf die Bilderflut, erkennen aber in der Verfügbarkeit der Bilder auch Möglichkeiten für einen anderen Umgang. Die französische Avantgarde-Zeitschrift Documents ist die Publikation, die davon am radikalsten Gebrauch macht. Hier arbeiten Georges Bataille, Carl Einstein und Michel Leiris mit der Deregulierung der Abstände zwischen den Bildern und zwischen Bildern und Texten mit dem Ziel, bürgerliche Gewissheiten über Kunst und Wissenschaft zu demontieren. Die mediale Erfahrung von Fotografie und Film zeigt sich an der Ausbildung neuer künstlerischer Verfahren auch da beteiligt, wo kein analoges Bildmaterial verwendet wird. Das dritte Kapitel analysiert Materialauswahl und Formen der Montage in Max Ernsts Collageromanen. Dieser bezieht sich explizit auf die Bewegungsfotografie des ausgehenden 19. Jahrhunderts und nutzt sie als Modell für die Erzeugung surrealistischer Effekte. Die Verwendung von naturwissenschaftlichen Abbildungen und Romanillustrationen bringt die Trennung zwischen den Bereichen zum Einsturz. Max Ernsts Technik der nahtlosen Verfugung lässt hybride Bildwelten entstehen. Ziel der Arbeit ist es, quer zu den stilgeschichtlichen Einordnungen die Veränderungen in den Bildpraktiken zu denken, und mit den Einzelanalysen die These von der experimentellen Produktivkraft der analogen Medien für die visuellen Kulturen im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit zu belegen.
-
Das Fotoatelier als Ort der Moderne : zur fotografischen Praxis von Marie Bashkirtseff und der Gräfin von Castiglione
(2015)
-
Anja Herrmann
- Anja Herrmanns Dissertation stellt die bislang unsystematisch untersuchte Frage nach der Rolle der großen Fotoateliers für die private Selbstrepräsentation in den Zusammenhang einer Neuordnung der Räume in der Moderne. Schauplatz ist Paris in der Zeit seit den 1860er-Jahren. Die Epoche ist zentral, da sich die Stadt grundlegend durch Abriss und Neuplanung unter Baron Haussmann veränderte: Grands Boulevards, Warenhäuser, Börse, neue Oper sowie unzählige Bars, Varietés und Theater – nicht zuletzt große Fotoateliers – verhalfen Paris zu jener Topografie, die das Vergnügen mit dem Kommerz verband, weshalb sie für Walter Benjamin zur Hauptstadt des 19. Jahrhunderts avancierte. Anhand ausgewählter Inszenierungen von Marie Bashkirtseff und der Gräfin von Castiglione und über vorfotografische Inszenierungsformen wie der Attitüde und dem Tableau vivant wird der Frage nachgegangen, wie in der spezifischen Öffentlichkeit des Fotoateliers Muster der Selbstdarstellung und des Blicks entwickelt wurden, die durch einen hohen Grad schichten- und geschlechtsspezifischer sowie medialer Reflexivität eine moderne Praxis visueller und performativer Weiblichkeit offenbaren.
-
Gerda Taro und Robert Capa: zur fotografischen Praxis im Spanischen Bürgerkrieg
(2025)
-
Linda Sandrock
- Gerta Pohorylle (1910-1937) und André Friedmann (1913-1954) begegnen sich 1934 im Pariser Exil und kreieren dort gemeinsam ihr Image als Gerda Taro und Robert Capa, um bereits kurz darauf, im August 1936, nach dem Putschversuch der Offiziere vom 17. Juli, als Fotoreporter nach Spanien zu reisen. Die Fotografien, die nun in den ersten Wochen einer Revolutionseuphorie und dann in den Jahren des Bürgerkriegs (1936-1939) entstehen, ebenso wie die besondere Art der Zusammenarbeit von Taro und Capa sind Gegenstand der Dissertation.
Dabei stützt sich die Arbeit auf einen breiten Materialkorpus, der neben Vintageprints auch Negativfilme und -streifen sowie acht Arbeitshefte mit Kontaktabzügen umfasst. Zudem werden die vielfältigen Gebrauchsweisen der Fotografien – ihre Nutzung und Reproduktion in der illustrierten Presse, in Bildbänden und Fotobüchern oder ihre durch analogen Schnitt erfolgte Einfügung in Filme –, die das Migrationspotenzial des Fotografischen offenlegen, berücksichtigt.
Die Dissertation beleuchtet verstärkt die Produktionsseite und verortet die Fotografien diskursanalytisch in ihren sozialen, kulturellen, ideologisch-politischen und ästhetischen Entstehungskontexten. So wird herausgestellt, dass Capas und Taros fotografische Praxis nicht nur im Kontext von Kriegsfotografie und Neuem Sehen – beides Kategorisierungsversuche bisheriger Rezeption –, sondern insbesondere auch im Umfeld der Arbeiterfotografie der 1920er und 1930er Jahre zu betrachten ist, wird doch der Spanische Bürgerkrieg zum Kampfplatz ideologischer Auseinandersetzungen zwischen linken und rechten Weltanschauungen stilisiert. Fotografie ist für Taro und Capa ein Mittel, sich als Teilnehmer am Spanischen Bürgerkrieg zu imaginieren sowie sich in politischen, literarischen und künstlerischen Intellektuellenkreisen zu etablieren. Fotografie wird als soziale Praxis greifbar.
Wesentlich stützt sich die Arbeit auf Dispositiv- und Handlungstheorien, die Fotografie als ein Handlungsgefüge, einen Akt, ein Ereignis beschreiben und dem Medium eine eigene Wirkmacht und eigene Agenzien zugestehen. D.h. die dem Sujet Kriegsfotografie geschuldeten Grenzen, Möglichkeiten und Effekte des Fotografischen geraten in den Blick. Mit Taros Tod an der Front im Juli 1937 oder Capas bekanntem Bild eines fallenden Soldaten wird aufgezeigt, dass die Momente von Zeugenschaft und Evidenz tragende Authentizitätseffekte der Fotografien des Spanischen Bürgerkriegs sind. Auch wird dargestellt, dass Taro und Capa das Medium Fotografie an den Grenzen von angewandter und künstlerischer bzw. ästhetischer Praxis lokalisieren. Im Experiment und in den Zwischenräumen fotografischer Praktiken erlangen sie ein Verständnis für die Bedingungen und Effekte des Fotografischen.